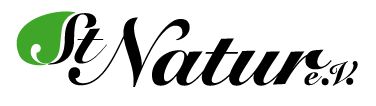„Wir haben die Erde nicht
von unseren Vätern geerbt,
sondern von unseren
Kindern geliehen !“
Dass uns die Welt, in der wir leben, nur zu treuen Händen gegeben ist, damit wir sie unversehrt und in ihrer ganzen Vielfalt auf die nächsten Generationen weitergeben;
dass wir nur den Überschuss abschöpfen dürfen, aber die Substanz nie zerstören oder unwiederbringlich verändern dürfen.
Zum größten Teil verläuft der Rundgang über Gemeindewege. Wir machen darauf aufmerksam, dass der Rundgang auf eigene Gefahr und Verantwortung erfolgt. Eltern haften für ihre Kinder.
Zwischen Station 3 +4 (Anstieg zur PWH) und 10 bis 12 (Hohlweg) ist festes Schuhwerk notwendig und bei Nässe weniger für Kinderwagen geeignet.
Die Gesamtlänge beträgt ca. 4 km.
Verhalten
Die ersten Meter gehen wir an Weideflächen vorbei, wo wir je nach Jahres- und Tageszeit Pferde und Kühe sehen. Bitte füttern Sie diese Tiere nicht. Die Tiere werden von ihren Besitzern gepflegt und betreut und es fehlt ihnen an nichts!
Übrigens Kühe sind kurzsichtig und neugierig. Gehen Sie einfach weiter.
Auch Wildtiere stört normales Gehen und eine Unterhaltung nicht.
Wir bitten Sie, Früchte auf den Grundstücken den Eigentümern oder den nächsten Besuchern zum Anschauen zu belassen.
Müll und Abfall haben in der Natur nichts verloren und sind mitzunehmen.
Bleiben Sie bitte auf den Wegen. Danke !
Dieser Weg wird ehrenamtlich betreut und gepflegt.
Spenden zur Erhaltung und Erweiterung sind immer herzlich willkommen.

Dickung (Pfosten 1)
Dieser Grünstreifen vor uns war einmal eine Baumreihe mit Obstbäumen.
Da seit vielen Jahren nichts gemacht wurde, hat sich die Natur die Fläche zurückgeholt.
Damit ist eine Artenvielfalt entstanden. Lebewesen die abgestorbene Hölzer brauchen und viele Schmetterlingsarten, die auf die Brennnesseln für ihren Nachwuchs (Raupen) angewiesen sind.
Sie dient auch zum Einstand von Wildtieren wie z.B. Fasan, Fuchs, Hase oder Rehen.

Arten, Sorten, Beispiele für Sträucher
Die nachfolgende Übersicht enthält Beispiele für winterharte Sträucher mit Dornen oder Stacheln, die man in Deutschland, Österreich und der Schweiz im einschlägigen Pflanzenhandel kaufen kann. Dabei werden die Sträucher zunächst nach sommergrünen und immergrünen Arten unterschieden (Blattabwurf). Anschließend erfolgt in jeder Liste eine Bestimmung der Wuchshöhe, Wuchsgeschwindigkeit (langsam wachsend, schnellwachsend), Herkunft (einheimisch, nicht heimisch) und Licht-Bedürfnisse (Sonne, Halbschatten, Schatten).
Im Vorfeld wird erläutert, wonach man bestimmen kann, ob ein Strauch Dornen oder Stacheln aufweist.
Was sind Dornensträucher?
Der Begriff „Dornenstrauch“ stammt nicht aus der Botanik, sondern aus der Umgangssprache. Er bezeichnet in diesem Lexikon Sträucher, an deren Ästen sich spitze Dornen (Blattdornen, Sprossdornen) oder spitze Stacheln befinden. Speziell größere Dornensträucher haben eine wichtige Funktion für Vögel gegenüber natürlichen Angreifern wie einer Katze, einem Marder oder einem größeren Raubvogel. Sie dienen beispielsweise als Nistplatz, Nisthilfe, Ruheplatz oder Schutzraum und eignen sich deshalb zum Anlegen einer Vogelschutzhecke. Außerdem eignen sich größere Dornensträucher zum Pflanzen einer unüberwindbaren und undurchdringbaren Schutzhecke, die den Garten wie ein natürlicher Zaun abgrenzt. Bei vielen Beeren- und Obststräuchern handelt es sich um Sträucher mit Dornen oder Stacheln, die auf diese Weise ihre Früchte vor Tierverbiss schützen.
Bestimmen von Stacheln und Dornen
Sträucher mit Dornen bilden diese aus den Sprossachsen (sog. Sprossdornen) oder Blättern und Nebenblättern. Sprossachsen transportieren Kohlenstoff, Mineralien, Stickstoff, Schwefel, Phosphat und Wasser zwischen Blätter und Wurzeln und stabilisieren die Pflanze. Weil Dornen aus dem Pflanzenkörper herauswachsen und fest mit diesem verbunden sind, können sie nicht abgebrochen werden, ohne den Zweig abzubrechen, auf dem sie sich befinden. Im Unterschied dazu bilden Sträucher mit Stacheln diese aus äußerem Gewebe der Sprossachse, Blättern (Epidermis) und der Rinde an ihren Langtrieben. Stacheln befinden sich folglich auf der Außenhaut einer Pflanze und können relativ leicht abgebrochen werden. Weil Dornen aus Sprossachsen oder Blätter entstehen, enthalten sie Leitungsbahnen (Leitbündel), was bei Stacheln nicht der Fall ist. Entgegen dieser Definition werden die Begriffe Dornen und Stacheln umgangssprachlich synonym verwendet. So weisen Stachelbeeren botanisch Dornen auf statt Stacheln und Rosen besitzen botanisch Stacheln anstelle von Dornen. Ebenso werden Blattdorne an den Langtrieben von Sträuchern in der Umgangssprache gerne Stacheln genannt. Weil die meisten Dornensträucher Sonne oder Halbschatten benötigen, kann nach der Wurzelentfernung die entsprechende Stelle mit einer dunklen Teichfolie und ggf. darauf liegendem Kies abgedeckt werden. Auf diese Weise lassen sich Dornensträucher dauerhaft aus dem Garten entfernen, weil eine Photosynthese mangels Lichtaufnahme über die Blätter nicht mehr möglich ist und verbleiben Restwurzeln im Boden absterben. Abgeschnittene Wurzelbestandteile sollte man nicht auf dem Komposthaufen, sondern außerhalb des Gartens z.B. in der Biotonne oder im Wertstoffhof entsorgen.
Streuobst (Pfosten 2)
Historische Lage Obst
Vom Mittelalter bis herauf ins 19. Jahrhundert änderte sich an der Art der
Baumpflanzung und –pflege sehr wenig. Der Hausgarten versorgte die
bäuerliche Familie mit frischem Obst.
Der Vorrang wurde dem traditionellen Getreide- und Futteranbau gegeben.
Erst die „Verkehrswege“ erlaubten den Handel mit Obst und dadurch die
Einnahme von Bargeld für die Landwirtschaft.
Hochstamm
Die Hochstämme konnten sich in der Breite (10 x 20 m) und Höhe (10-15 m) noch frei entfalten. Geschnitten wurde wenig bis gar nichts. Der Hektarbestand liegt dann bei ca. 25 Bäumen. So konnte dazwischen noch Gras und Heu als Viehfutter gewonnen werden. Außerdem wurde der Raum zwischen und unter dem Hochstämmen für den Ackerbau genutzt. Dabei konnten die Birnbäume ein Lebensalter von 300 Jahren und die Apfelbäume von 100 Jahren erreichen. Der klassische Hochstamm hat als Unterlage einen kräftigen Wuchs oder Wildlinge und die Äste beginnen in ca. 2 Meter. Genug Platz für Pferd und Mann.

Halbstamm
Die Halbstämme mit Baumabständen von unter 8 Meter wurden bis zu 9 Meter hoch, der Hektarbestand liegt dann bei ca. 100 Bäumen. Der Baumschnitt beschränkte sich auf den Pflanzschnitt und auf das Auslichten zu dicht stehender Äste. Um die Erträge zu steigern, begann man die Obstbäume reichlicher als die Wiese zu düngen. Der Boden unter den Bäumen wurde in Form runder „Baumscheiben“ umgearbeitet. Die Wurzel eines Baumes sind genauso mächtig wie die Baumkrone. Wasser und Nährstoffe bekommt der Baum außerhalb der Baumkrone. Früher hat der Bauer beim Pflügen im Herbst seine Erdschollen nach oben zum Berghang hin gedreht, damit wurde der Mutterboden von seinem Feld, der durch Schwerkraft und Wasser nach unten verschoben worden war, wieder zurückverlagert. Heute rutscht das Feld immer weiter den Hang herab, wird dadurch größer und der umsäumende Weg immer kleiner. Früher wurde jedes Pferd blockiert, wenn der Bauer mit seiner Pflugschar an einen Grenzstein kam. Bei den heute geläufigen Traktoren finden wir oft „ausgepflügte“ Grenzsteine. Was strafbar ist.
Alte Sorten (Pfosten 3)
Obstsorten der Streuobstwiesen
Die alten Sorten, die auch heute noch traditionell im Streuobstanbau verwendet werden, wurden zu einer Zeit entwickelt, als Pflanzenschutzmittel gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stand. Sie sind daher gegenüber Krankheiten und Schaderregern als besonders robust einzustufen. Die einzelnen Sorten entstanden dabei regionsspezifisch. Beispielsweise der Mostviertler Holzapfel, der Erbachhofer, der norddeutsche Boikapfel, der Rheinische Krummstiel oder aber der Rheinische Bohnapfel. Die Verbreitung mancher Sorten ist gar auf wenige Dörfer beschränkt gewesen; es entstanden sogenannte Lokalsorten. Während die heutigen Kultursorten, die im Intensivobstbau verwendet werden, auf weitgehend einer Handvoll identischer Elternsorten zurückgehen, stellen die typischen alten Obstsorten der Streuobstwiese, damit ein großes genetisches Potential dar. Sie liefern ein wichtiges Reservoir für den Genpool der Kulturäpfel.
Ökologie der Streuobstwiesen
Die vielfältigen Ausprägungen sind auch Ausdruck landschaftsschützerischer Aspekte. Die Obstbäume können den Boden an Hängen vor Abtragung schützen, so dass eine Weidewirtschaft nachhaltig durchführbar ist. Die im 18. Jahrhundert typischen Streuobstgürtel der Siedlungen wirkten auch als Windschutz. Extreme Temperaturen werden abgeschwächt und die Windgeschwindigkeit vermindert. Mit ihren unterschiedlichen Wuchsformen, Blühzeiten und -farben sowie Herbstfärbungen nehmen sie eine gestalterische Funktion wahr.
Anbau von Obstsorten am Donnersberg
Zwischen Steinbach und dem Kloster Dreisen (Münsterhof) gab es früher eine enge Verbindung. Hier soll auch die Quelle liegen warum an den Hängen bei Steinbach früher sehr viel Obst zu finden war. Noch heute kennt man allein vier Sorten einer braunen Kirschen.

Kaltluft + Blick auf den Donnersberg (Pfosten 4)
Die Besonderheit am Berg
Kurz nach Sonnenuntergang entsteht ein dynamischer Prozess von Luftströmen, die sich schnell abkühlen. Kalte Luftströme vom Donnersberg die dichter und schwerer sind, fließen in tiefere Stellen hinein. Vergleichbar mit Wasser welches Flüsse bildet oder ganze Seen. Weiter unten bilden andere Flächen wie z. B. aufgewärmte Gebäudeoberflächen (Häuser) Barrieren, da diese sich langsamer abkühlen. Der Luftstrom kann vorbeifließen und eine Kaltfront aufbauen oder aber auch in einer gewissen Höhe über die wärmeren Teile darüberfließen. Ein kaum merkbarer Wind bringt dann nach Sonnenuntergang Kühle, obwohl eigentlich Windstille herrscht.
Auf der einen Seite eine angenehme Erfrischung an heißen Tagen, aber auch ein Problem der „Bergdörfer“ wenn Lärmquellen in der Nähe sind. Schall ist eine Schwingung von Luftmolekülen. Dabei bewegen sich die Luftmoleküle rechtwinklig zur Ausbreitungsrichtung . Je höher die Temperatur umso größer ist die Eigenschwingung der Luftmoleküle. Lärm breitet sich deshalb in sehr warmer Luft schlecht aus.
Anders ist dies bei kalter Luft. Alles was kalt ist – ist klein und dicht – auch Luft. Abends hört man dann Geräusche besser (lauter) und es kann auch wie eine Reflektorwand wirken. Man spricht hier von besonders klimatischen Bedingungen.
Die Wälder am und auf dem Donnersberg sind akut gefährdet. Immer neue Rekordtrockenheiten geben den Bäumen den Todesstoß. Von „apokalyptischen Bildern“ sprechen die Landesforsten Rheinland-Pfalz.
Das Drama verschließt sich auch dem ungeschulten Blick nicht. Hier, am Südhang des Donnersberges, entwickelt sich der Wald allmählich zu einem Baumfriedhof. Die ausgedehnten braunen Flecken sprechen für sich. Die Folgen des letzten Jahres kann man besonders deutlich sehen, wenn im Frühjahr die noch lebenden Bäume austreiben.
Was besonders beunruhigt ist, dass Eichen, Schwarzkiefern und Douglasien, absterben. Das sind eigentlich Trockenbaumarten!
Für den Landesforst wird es da knifflig, denn: Worauf soll man bei der weiteren Waldentwicklung setzen? Die steilen, karstigen Südhänge sind zwar die schlechtesten Standorte, die der Donnersberg zu bieten hat. Gleichwohl hatte man erwartet, dass diese Baumarten es überstehen. Der Blick in die Kronen ist in der Tat beunruhigend. Viele Eichen tragen noch das braune, ausgebleichte alte Laubwerk vom Vorjahr, das die Bäume im Herbst schon nicht mehr abwerfen konnten. Von frischen Trieben keine Spur. Dazwischen Bäume, deren Zweige nur dünn mit Trieben besetzt sind, die Spitzen der Zweige sind kahl.
Kiefern stehen schon ganz in Braun und Grau – die Schwarzkiefer, ist eine im Mittelmeerraum heimische und an sich anspruchslose Baumart.
„50 Prozent der Bäume hier sind tot oder im Absterben“, so die düstere Einschätzung zu dem Gesamtbild, das sich beim näheren anschauen bietet.
Dringend notwendig ist es jetzt Erfahrungen mit alternativen Baumarten machen zu können. Hier z.B. die Zerreiche, die in Ungarn verbreitet ist und gut mit dem dortigen trockenen Kontinentalklima zurechtkommt. Ähnlich der französische Ahorn. Artenvielfalt ist auch hier wichtig um ein breites Spektrum zu haben. Auf möglichst viele Baumarten zu setzen, weil man nicht wissen kann, wo genau die Reise hingeht. Es geht um Jahrzehnte.
Klimawandel ist ein viel zu schwaches Wort.
Man muss von einer Klimakatastrophe reden.
Börrstadt – Solarpark – Zementwerk (Pfosten 5)

Hinter sich im Süden sehen Sie den Ort Börrstadt in der sogenannten Börrstadter Senke, alternativ Kaiserstraßensenke genannt; im Norden geht es in die Dannenfelser Randhügel über.
Nachbargemeinden sind – im Uhrzeigersinn – Steinbach am Donnersberg, Standenbühl, Dreisen, Göllheim, Breunigweiler, Sippersfeld, Winnweiler und Imsbach.
Im südwestlichen Gebiet der Gemarkung erstreckt sich an der Gemarkungsgrenze zu Winnweiler und Sippersfeld der 400 Meter hohe Bocksrück.
Im äußersten Osten der Gemarkung verläuft in Süd-Nord-Richtung die Pfrimm.
Deren linker Nebenfluss Grundheckerbach, der vor seiner Mündung den Eichbach aufnimmt, fließt mitten durch das Börrstadter Siedlungsgebiet. Durch den Norden des Gemeindegebiets fließen außerdem der Laubbach (NaturErlebnisPfad Laubbachtal des Steinbacher Naturvereins e.V.),der Bach vom Hahnweilerhof und der von links in diesen mündende Forellenbach.

Ebenfalls im Süden
gelegen erkennt
man eine Photovoltaik Freiflächenanlage
(auch Solarpark).
Die Solarpark Börrstadt AöR ist eine gemeinsame Einrichtung der Verbandsgemeinde Winnweiler und der Ortsgemeinde Börrstadt.
Aufgabe der Anstalt ist der Bau und Betrieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Gewerbe- und Industriegebiet Börrstadt. Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsfürsorge. https://www.winnweiler-vgwerke.de/projekte/solarpark-boerrstadt/
Dabei handelt es sich um eine Photovoltaikanlage, die nicht auf einem Gebäude oder an einer Fassade, sondern ebenerdig auf einer freien Fläche aufgestellt ist. Eine Freiflächenanlage ist ein fest montiertes System, bei dem mittels einer Unterkonstruktion die Photovoltaikmodule in einem optimalen Winkel zur Sonne ausgerichtet werden.
Freiflächen und Umweltschutz
Die Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft hat gemeinsam mit Umweltorganisationen (NABU) 2005 einen Kriterienkatalog für die naturverträgliche Errichtung von Freiflächenanlagen veröffentlicht. Demnach sollen Flächen mit Vorbelastung und geringer ökologischer Bedeutung bevorzugt und exponierte Standorte auf gut sichtbaren Anhöhen gemieden werden.
Die Aufständerung soll so gestaltet werden, dass eine extensive Nutzung und Pflege des Bewuchses, z. B. durch Schafbeweidung, weiterhin möglich bleibt. Auf den Einsatz von Pflanzenschutz-mitteln und Gülle soll verzichtet werden. Naturschutzverbände sollen frühzeitig in Planungen einbezogen werden. Ein Monitoring dokumentiert die Entwicklung des Naturhaushaltes in jährlichen Begehungen nach der Errichtung. Die hier formulierten ökologischen Kriterien gehen über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus.
Untersuchungen aus dem Jahr 2013 zeigen, dass Solaranlagen einen Beitrag für die regionale Artenvielfalt haben können und durch die Installation eines Solarparks eine ökologische Aufwertung der Flächen im Vergleich zu Acker- oder Intensiv Grünlandnutzung möglich ist. Die älteste untersuchte Anlage erwies sich als die mit der größten Biotopvielfalt im Umland und als beste Anlage hinsichtlich der biologischen Vielfalt. Bereits nach kurzer Zeit führte die Extensivierung der landwirtschaftlichen Bearbeitung zu einer Zuwanderung von Schmetterlingen und einer steigenden Pflanzenvielfalt. Eine zu starke Beweidung wirkt sich negativ aus. Insbesondere von einigen mobilen Tierarten wie Schmetterlingen wurden die Flächen bereits nach kurzer Zeit neu besiedelt. Bei vier der fünf untersuchten Solarparks stieg die Artenvielfalt von Tieren, verglichen mit der zuvor betriebenen intensiven Ackernutzung, deutlich an.

Im Osten sehen Sie
die Anlagen und
Einrichtungen des
Zementwerkes Göllheim.
Es wurde in den Jahren 1961 – 1965 in unmittelbarer Nähe umfangreicher Rohmaterial-vorkommen erbaut. Damals gehörte es zu den modernsten Zementfabriken in Deutschland. Den Bedarf an Brennstoffen zum Brennen von Portlandzementklinker decken sie etwa zu 3/4 aus alternativen Brennstoffen.
Das für die Zementproduktion wichtigste Rohmaterial, der Kalkstein, wird in eigenen Steinbrüchen „Hohe Benn“ und „Zollstock“ abgebaut.
Ein Großteil der Klinkerproduktion wird bereits in Göllheim vorwiegend zu Portlandzementen vermahlen und anschließend per LKW zur Grauzementproduktion in das ca. 60 km entfernte Werk Amöneburg (Wiesbaden) transportiert.
Steinbach am Donnersberg – Keltengarten –
Pferde (Pfosten 6)
Im Norden sehen Sie vor sich alte Streuobstwiesen und die Südhänge des
Donnersberg mit dem Keltengarten.


Halbrechts, im Nordosten der Ort Steinbach am Donnersberg.
Die Streuobstwiese ist eine traditionelle Form des Obstbaus. Auf Streuobstwiesen stehen zumeist hochstämmige Obstbäume von oft unterschiedlichem Alter, Arten und Sorten. Der moderne, intensive Obstanbau ist dagegen von niederstämmigen Obstsorten in Monokultur geprägt (Obstplantagen).
Der Streuobstanbau hatte im 19. und in der ersten Hälfte des Jahrhunderts eine große kulturelle, soziale
landschaftsprägende und ökologische Bedeutung. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft sowie durch das Bau- und Siedlungswesen wurden jedoch Streuobstwiesen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark dezimiert. Heute gehören sie zu den am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas (siehe auch Rote Liste der Biotoptypen).
Weiterführende Informationen finden Sie auch unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuobstwiese#cite_note-7
NABU-Keltengarten

Der ca. 6 Hektar große Keltengarten soll das Leben, Arbeitswelt, Kultur und Naturraum zur Zeit der Kelten zeigen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz. Schautafeln informieren über Vorkommen und Bedeutung der Tier- und Pflanzenwelt.
Pferdehaltung
Entlang des NaturErlebnisPfades werden Sie immer wieder Pferde auf Koppeln in den Streuobstwiesen sehen. Deswegen haben wir als Anregung einmal Punkte für und dawider zusammengestellt:
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Wiese rund um die Obstbäume zu nutzen:
– die Wiese mähen
– Tiere weiden lassen
Die Mahd auf einer Streuobstwiese ist oft aufwändig, weil man meistens keine großen Mähwerkzeuge einsetzen kann. Deshalb lohnt es sich nur sehr selten, eine Streuobstwiese als Heuwiese zu nutzen. Trotzdem sollte das gemähte Gras nicht auf der Wiese verbleiben.
Außerdem ist zu bedenken, dass große Mähwerkzeuge problematisch für kleine Säugetiere, Insekten und bodenbrütende Vögel sein können. Die Auswahl des Mähwerkzeugs und der Zeitpunkt der Mahd sollten also bedacht werden.
Wenn man Tieren das „Mähen“ der Wiese überlässt, muss die Anzahl der Tiere zur Größe der Wiese passen. Außerdem sollten die Tiere nicht dauerhaft auf der Streuobstwiese weiden. Sonst kann es durch den Tierkot zu einem Überangebot an Nährstoffen kommen.
Die meisten Weidetiere machen auch vor Obstbäumen nicht halt. Deshalb müssen die Bäume der Streuobstwiese vor Verbiss geschützt werden. Je nach Tierart kann ein Stammschutz ausreichen oder ein richtiger Zaun um die Bäume nötig sein.
Am besten geeignet für die Beweidung von Streuobstwiesen sind Schafe und Rinder. Pferde gelangen auch an höhere Äste und schädigen die Grasnarbe besonders stark. Ziegen verbeißen Obstbäume sehr stark und sollten deshalb nur kurzfristig auf Streuobstwiesen weiden.
Aufgrund der Nährstoffverfügbarkeit ist es sinnvoll, alte traditionelle Rassen für die Beweidung zu nutzen. Sie sind genügsamer.
„Pro“ Streuobstwiesen für Pferde

- Ein Bonus von Streuobstwiesen ist in jedem Fall der Schatten, den die Bäume im Sommer spenden.
- Das Gras- und Kräuterangebot ist auf Obstwiesen abwechslungsreicher als auf baumlosen Wiesen.
- Obstbäume sind nicht giftig. Das gilt sowohl für die Früchte, als auch für Rinde und Blätter.
- Selektives Fressverhalten von Pferden und ihre Ausscheidungen sorgen für einen vielfältigen Pflanzenwuchs.
- Hochstämmige und ausreichend hoch gewachsene Obstbäume sind robuster und bieten den Vorteil, dass die Pferde das erntefrische Obst nicht so leicht „pflücken“ können.
- Bei dieser Form der Beweidung werden dem Boden weniger Nährstoffe entzogen als durch eine Mähgutabfuhr.
„Contra“ Streuobstwiesen für Pferde
- Der Verzehr von übermäßigen Obstmengen kann das Pferd krankmachen.
- Steinobst (z.B. Kirschen und Pflaumen“ sind für Pferde Tabu.
- Bei jungem, kleinem Obstbaumbestand auf der Wiese können Pferde die Rinde beim Anknabbern schädigen oder gar zerstören.
Bienen-Blick (Pfosten 7)
Unser Standort ist etwa 225 Meter über NN, der Donnersberg vor uns hat eine Höhe von 678 m und auf der Spitze sehen wir den ca. 200 m hohen Fernsehturm. Dieser ist etwas mehr als 3 km entfernt. Wenn wir waagrecht schauen sehen wir etwas links vom Fernsehturm einen Bienenstand mit 4 bis 5 Völker. Ein optimaler Standort und auch eine sinnvolle Einheit, der nicht zum Stress der Völker führt. Im Sommer sind dort ca. 150.000 Bienen zuhause.
Wirtschaftliches Arbeiten bei den Bienen
Das Fliegen der Bienen ist Arbeit und verbraucht Energie, d.h. bevor Bienen los fliegen nehmen sie in ihrem Honigmagen erst einmal eine „Honigportion“ aus der Beute (Bienenwohnung) mit.
Vorher haben die Bienen untereinander kommuniziert. Außer dem Menschen kommunizieren nur noch Honigbienen über Lage, Ort und Futterquelle. Anhand von Sonnenstand und Magnetfeld wird die Richtung und die Entfernung, Qualität und Duft weitergegeben. (Jeder Flug erweitert so ihre Karte im Gehirn.) So informiert fliegt die Biene dann zu der einzelnen Blumenart. Das Anfliegen nur zu einer Sorte ist charakteristisch für die Honigbiene im Gegensatz z.B. zu der Hummel. Man nennt das blütenstetig. Wissenschaftler sehen darin ein Optimieren der Honigsammlung. Es ist aber auch die effektivste Bestäubung, weil nur eine Art angeflogen wird. Bei einem Flug von einer Apfelblüte zur Birnenblüte zur Kirschblüte, wäre keine Bestäubung erfolgt, weil artenfremd.
Für die Anreise zur Nahrungsquelle nimmt sie so viel mit wie sie braucht. Die Biene kennt ja die Entfernung aus dem Gedächtnis oder Kommunikation. Diese maximale Fluggrenze liegt bei ca. 9 km. Dies wäre aber unwirtschaftlich da dann genauso viel raus wie rein gebracht werden würde. Der Nektar, den die Biene mitbringt besteht zunächst aus 80% Wasser.
Die Bienen sehen deshalb wirtschaftliches Eintragen von Nektar bei ca. 3 km bei besonderen Bedingungen auch ein bisschen mehr, wie zwischen Standort und Fernsehturm mit ca. 3,5 km. Dieser Radius ist also das Arbeitsgebiet einer Honigbiene. Von hier bis zum Bienenstand sind es 350 Meter.
Minimale Flugtemperatur ist ca. 12°C. Die Temperatur in der Beute liegt im Winter ohne Brut bei ca. 15°C. Die Biene, die als Insekt ein Kaltblütler ist, erwärmt das Volk durch zitternde Muskelbewegungen. Auch dazu benötigt sie viel Honig (getrockneter und aufbereiteter Nektar mit nur noch ca. 20 % Wassergehalt). Die Brut (Larven in den verschiedenen Stadien) braucht 35°C.
Viele Wildbienen haben einen kleineren Sammelradius, der oft um die 150 Meter liegt. Die Hummel kann bei wesentlich niedrigerer Flugtemperatur fliegen. Eine Hummelkönigin übersteht den Winter, mit „Frostschutzmittel“ im Blut. Eingefroren irgendwo im Boden oder einem Mäusegang. Eine Honigbiene dagegen braucht ihre 5.000 bis 10.000 Winterbienen, damit sie am Leben bleibt. Das ist die einzige Aufgabe dieser Winterbienen, die dafür aber auch ein halbes Jahr leben. Die Honigbienen, die im Sommer arbeiten, Nektar eintragen und aufbereiten, leben nur 2 bis 6 Wochen. Dieser Standort, den wir dort sehen, ist ideal für die Bienen und ideal für Imker. Geschützt vom West- und Ostwind. Die Sonne kommt morgens schon früh hin und weckt die Bienen. Zum Westen verschwindet die Sonne eher als sie tatsächlich untergeht und verführt damit abends nicht noch die Biene zu einem späten Ausflug. Wichtig für den Imker, der von April bis zur Sommersonnenwende wöchentlich zum Volk muss, will er seine Bienen nicht verlieren. Bienenvölker in der Natur ohne Imker überleben heute maximal 2 Jahre alleine.
Für weitere Informationen steht der vom Steinbacher Naturverein e.V. 2021 eröffnete Bienenlehrpfad (für weitere Informationen siehe Homepage) gleich um die Ecke zur Verfügung.
LANDWIRTSCHAFT
Gefahr durch Monokulturen
Monokulturen in der Landwirtschaft senken die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen Um diese Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen ist es in Deutschland schlecht bestellt. Ein Drittel aller Arten ist gefährdet. Dafür ist aber nicht der Klimawandel primär verantwortlich, sondern die Zunahme von Monokulturen in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist sowohl Opfer, als auch Verursacher des globalen Klimawandels. 10-12 % der weltweiten anthropogenen Treibhausgas-Emissionen stammen aus der Landwirtschaft. Von den rund 48.000 Tierarten, 9500 Pflanzen- und 14.400 Pilzarten in Deutschland stehen bereits über 32.000 Arten auf der Roten Liste. Besonders dramatisch ist die Lage bei den wirbellosen Tieren wie den Insekten. So sind alle 600 existierenden Wildbienenarten bedroht. Von den Wirbeltieren wie Säugetieren, Süßwasserfischen, Reptilien, Vögeln und Amphibien sind fast 28 % gefährdet. Besonders verschlechtert hat sich die Situation der Brutvögel. In den letzten zwölf Jahren nahm der Bestand um 34 % ab.
Insbesondere „Allerweltsarten“ wie Kiebitze, Uferschnepfen und Feldlerchen sind immer weniger zu sehen. Kiebitze haben etwa ein Drittel an Bestand verloren, das Rebhuhn ist bereits zu 90 % verschwunden. Auf der Roten Liste stehen auch über 23 % der Zugvogelarten. Früher hat der Bauer auch mal ein paar Halme stehenlassen. Der Feld-hamster und Vögel fanden Nahrung. Heute hingegen setzen die Landwirte auf Monokulturen und verwerten auch noch den letzten Grashalm. Die Lebensräume der Arten verschwinden auch durch den Einsatz von Dünger und Pestiziden, dem intensiven Fischfang und dem Trockenlegen von Flächen. Weitere Gefährdungen liegen in der Forstwirtschaft, im Wasserbau und der Gewässerunterhaltung, Baumaßnahmen sowie Sport und Freizeitaktivitäten. Inzwischen befinden sich etwa 77 % der geschützten Lebensräume in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand.
Aus Raps und Mais lassen sich Biodiesel und Biogas nahezu klimaneutral herstellen. Doch der großflächige industrielle Anbau von Bio-Energiepflanzen wirkt sich negativ auf die Biodiversität aus.
Diese Biodiversität ist für unser menschliches Zusammenleben, für unsere Wirtschaft und für die Funktionsweise der Biosphäre wichtig. Wenn wir daran denken, dass viele Ökosystemleistungen, von denen wir profitieren – sei es Bestäubung, sei es ein gesunder Wasserkreislauf, die Luftreinhaltung und so weiter – daraus resultieren.
Monokulturen schaden den Böden.
Außerdem nehmen sie den Tieren Lebensraum und sind langfristig unwirtschaftlich !

Lebensraum Eiche (Pfosten 8)
Botanisch gesehen, gehört die Eiche zur Familie der Buchengewächse und ist in ganz Europa verbreitet. Es gibt bei uns zwei einheimische Eichenarten. Die Stieleiche und die Traubeneiche. Sie unterscheiden sich anhand der Standorte und der Früchte. Mit einem Anteil von 10 % an der Waldfläche sind Stiel- und Traubeneichen zusammen, die nach der Buche bedeutendste Laubbaumart.
Die Traubeneiche ist mit ihrem stabilen, tiefreichenden Wurzelsystem tolerant gegenüber sommerlicher Trockenheit und Wärme. Damit ist sie ein wichtiger Baum im Klimawandel. Sie erreicht bei einer Lebenszeit von bis zu 500 Jahren eine Höhe von 20 bis 40 Metern. Die Stieleiche bevorzugt eher tonhaltigere und feuchte Standorte.
Weitere häufiger verwendete Eichenarten sind Rot- und Sumpfeichen (aus Nordamerika). Eichen gehören übrigens, ganz im Gegensatz zu Birke, Erle, Esche und Fichte, zu den langsam wachsenden Bäumen und sind als Lichtbaum unbedingt auf ausreichenden Lichteinfall angewiesen.
Lebensraum: Eichen werden auch als Tierheim der Natur bezeichnet. Wohl keine andere Baumart in Europa beherbergt mehr Insektenarten als die Eiche. Allein ca. 400 Schmetterlingsarten, über 100 Käferarten und viele Zweiflügler leben direkt oder indirekt von oder mit ihr. Auch Moose, Flechten und Pilze finden auf der rauen Borke oder den Blättern einen passenden Lebensraum. Diverse Schmetterlingsarten – vor allem Raupen vom Frostspanner, Eichenwickler und Eichenprozessionsspinner führen aufgrund ihrer großen Eichenliebe regelmäßig einen Kahlfraß durch, so dass die Eichen ein 2. Mal austreiben müssen (Johannistrieb, Ende Juni).
Nutzung: Eichenholz steht für hohe Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Widerstandskraft gegen Holz zersetzende Pilze und Meerwasser. Daher war das Holz früher für Schiffsbau und Fachwerkhäuser so begehrt. Für ein einziges Kriegsschiff benötigte man 1.200 alte Eichen! Pfahlbauten und Gebäuden auf feuchten Standorten standen früher ebenso auf Eichenpfosten. Auch für die Fertigung von Fässern für Wein und Whisky nimmt man am liebsten Eichenholz. Es gilt also mit diesem wertvollen Rohstoff nachhaltig umzugehen und die Wachstumsbedingungen dauerhaft zu erhalten.
Eine Geschichte erzählt von einem Fürst, der gern feierte und eines Tages in einer Winternacht all seine Ländereien verspielte. Seine letzte Bitte an den neuen Besitzer war: Er möge noch eine letzte Ernte einbringen. In Anbetracht des neu gewonnenen Reichtums gewährte man ihm diese Bitte gern. Schon am nächsten Tag begann der Fürst das Land mit Eichen zu bepflanzen, die bis zur Ernte Jahrhunderte brauchen. So konnte er dennoch sein Land behalten. Heute ein riesiger Eichenwald, viele hunderte Jahre alt und stehen immer noch (Kassel – Reinhardswald).
Leben im Totholz
In 10 Meter Entfernung, Richtung Norden, sehen Sie zwei noch stehende Totholz-Habitate (Lebensräume). Diese bieten einen einzigartigen Lebensraum für zahlreiche Lebewesen und dient zudem als wichtiger Nährstofflieferant für den Boden. Je nach Holzart und Zersetzungsgrad sind etwa 600 Großpilzarten und rund 1350 Käferarten an der vollständigen Remineralisierung eines Holzkörpers beteiligt.
Man unterscheidet zwischen stehendem Totholz, also noch nicht umgefallenen abgestorbenen Bäumen und liegendem Totholz, das bereits umgestürzt ist und auf dem Erdboden liegt. Beide Totholzarten spielen im Ökosystem eine zentrale Rolle und bieten die Lebensgrundlage für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Stehendes Totholz ist seltener, bietet aber die größere Vielfalt an Standortfaktoren und ist daher ökologisch wertvoller. Totholz ist ein charakteristisches Merkmal natürlicher Umwelt, so ist sein Anteil bei Mitteleuropäischen Urwäldern 10 – 30%, hingegen bei reinen Wirtschaftswäldern bei nur 1- 3 %.
Die ersten Organismen, die einen geschwächten Baum befallen, sind meist Pilze oder Insekten. Sie zersetzen Holz und Laub. Dies öffnet vielen anderen Tieren und Pilzen den Zugang zum „Schlaraffenland“. Der tote Baum dient als Nahrungsquelle, Lebensraum und Brutstätte zugleich. Wo Insekten sind, da sind auch Vögel, die sich über das Nahrungsangebot freuen. Spechte klopfen die Rinde ab und schlagen kleinere Löcher in das Holz, um an die Insektenlarven im Inneren zu gelangen. Außerdem bauen sie im Totholz die bekannten Spechthöhlen, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Zudem profitieren sämtliche Säugetiere von dem großen Angebot an Nahrung aus dem abgestorbenen Bäumen. Fledermäuse fangen in der Dämmerung fliegende Insekten. Wildschweine und Dachse laben sich an Käfern oder deren Larven. Die Artenvielfalt, die durch das Totholz profitiert und überlebensfähig bleibt, ist beeindruckend.
Das Totholz sorgt zudem für einen nährstoffreichen Boden. Dieser bietet der Vegetation gute Wuchsbedingungen. Zudem beherbergt ein nährstoffreicher Boden deutlich mehr Mikroorganismen, die das organische Material schneller zersetzen und den Boden zusätzlich durchlüften und auflockern. Dadurch kann der Waldboden mehr Wasser aufnehmen und speichern.
Daher sollten wir uns an der unberührten Natur erfreuen und den Zerfall von Hölzern seinen natürlichen Lauf überlassen. Jeder Eingriff durch den Mensch oder Maschinen wird zum Nachteil für die Natur.
Hohlweg (Pfosten 9)
Ein Hohlweg ist ein Weg, der sich durch jahrhundertelange Nutzung mit Fuhrwerken und Vieh, sowie abfließendes Regenwasser, bis zu 10 Meter tief in das umgebende Gelände eingeschnitten hat.
Entstehung
Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts waren Wege und Straßen mit unbefestigten Oberflächen ausgestattet. Dabei bildeten sich Hohlwege an den Standorten aus, an welchen durch den mechanischen Druck der Wagenräder und durch die ständige Beanspruchung der Wegflächen durch Huftritte der Zug- und Lasttiere die obere Bodenschicht verdichtet wurde. Das fein zermahlene Bodenmaterial wurde durch Oberflächenwasser bei Regenereignissen abtransportiert. Der fortwährende Bodenabtrag ist die wesentliche Ursache für die Entstehung der Hohlwege. Nur in wenigen Fällen wurden die Wege bewusst vom Menschen angelegt.
Beschreibung
An den Flanken der Hohlwege siedeln sich Stauden und Gehölze an, die Kleintieren als Unterschlupf und Nahrung dienen. Darum locken Hohlwege abends und nachts Fledermäuse an, die hier Jagd auf Nachtfalter und andere Insekten machen. Für landwirtschaftliche Gebiete und Wälder sind Hohlwege eine ökologische Bereicherung.
Durch menschliche Nutzung entstanden, droht den Hohlwegen heute durch Menschen, wie auch durch Bodenerosion Verfall. Ungenutzte Hohlwege verwuchern oder rutschen zu. Heute arbeiten vielfach Bürger und Behörden zusammen, um Hohlwege als Bodendenkmäler zu erhalten; früher und heute wurden und werden sie oft mit Bauschutt oder Gartenabfällen verfüllt.
Brache/ Blühstreifen (Pfosten 10)
In der früheren Landwirtschaft werden in einem dreijährigen Zyklus nacheinander Winter- und Sommergetreide angebaut, danach herrschte ein Jahr Brache, in dem sich der Boden erholen konnte. Da die Wiederbearbeitung des brach liegenden Feldes meist wieder im Juni des Folgejahres geschah, war die alte deutsche Bezeichnung für diesen Monat Brachet oder Brachmond.
Blühstreifen, Blühflächen und andere Blühkulturen sieht man zunehmend in unserer Landschaft. Als bunte Farbtupfer erfreuen sie nicht nur blütenbesuchende Insekten wie Honigbienen, Hummeln, andere Wildbienen und Schmetterlinge, sondern auch das menschliche Auge. Möchte man die Lebensbedingungen für Bienen und andere Tiere der Agrarlandschaft verbessern, so gibt es mehrere Möglichkeiten, die sich im Idealfall gegenseitig ergänzen. Neben den Blühflächen und Blühstreifen gibt es noch eine Reihe weiterer Kulturen wie „Lichtäcker“, Getreideanbau mit blühenden Untersaaten, bunt blühende Mischkulturen, Biogas Blühkulturen und extensive, lang blühende Leguminosen-Kulturen. Selbstbegrünte Brachen sind keine eigentliche Kultur (sie werden nicht angesät), doch aus den Erfahrungen der Phase der Flächenstilllegung weiß man, dass sich auf bestimmten mageren Böden, nach der Ernte der Vorfrucht, sehr interessante und vielfältig blühende Flächen entwickeln, die dadurch sehr kostengünstig Vielfalt in die Landschaft bringen. Blühstreifen und -flächen können neben dem Schutz der biologischen Vielfalt noch etwas ganz anderes bewirken:
Sie machen einfach Freude und Spaß beim Ansehen!
Blühflächen, Mischkulturen, extensive Getreide- und/ oder Leguminosen Kulturen sowie selbstbegrünte Brachen bilden das Konzept und Spektrum der notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen. Diese sind in unserer Agrarlandschaft nötig, um zu einem naturverträglichen Mit- und Nebeneinander von intensiver Nutzung und extensiver Nutzung zu kommen.

Kleinklima Saum (Pfosten 11)
Die Entwicklung der Saumbiotope ist historisch mit der landwirtschaftlichen Nutzung verbunden. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden viele Hecken gerodet um die nutzbare Fläche zu vergrößern. Heute ist ein Bewusstseinswandel eingetreten und Saumbiotope werden wieder gezielt angelegt, da sie eine große Strukturvielfalt besitzen und zu den artenreichsten Biotopen zählen. Die Artenzusammensetzung von Saumstrukturen wird jedoch auch von den Arten der angrenzenden Flächen bestimmt, da diese von dort aus einwandern. Man hält die Auswirkungen großflächiger Migrationprozesse für wichtiger als das Reservepotential der Saumbiotope.
Hecken
Hecken sind linear ausgeprägte Strauchformationen in freier Feldflur mit vorgelagerten Säumen.
Sie besitzen aufgrund ihrer linearen Struktur ein Maximum an Austauschbeziehungen zu ihrem Umland, was ihren überproportionalen Bestand an Tieren erklärt.
Sie ermöglichen vielen Tier und Pflanzenarten ein Überleben in der heutigen Agrarlandschaft. Abhängig von deren Exposition, weisen Hecken verschiedene Habitat- und Mikroklimazonen auf.
Sie sind reich strukturiert, haben vorgelagerte Säume und einen strauchförmigen Mantel. Ältere Hecken haben oft eine Baumschicht. Wenn man sie mit natürlichen Landschaftselementen vergleicht, ähneln sie am meisten den natürlichen Waldrändern. Man kann Hecken auch als in die freie Landschaft gerückte, doppelte Waldränder verstehen. Dadurch, dass sie auf engstem Raum verschiedene Strukturen und Kleinklimate aufweisen, bieten sie auch wenig mobilen Arten die Möglichkeit auszuweichen. Ein Ausweichen ist zum Beispiel notwendig, um sich vor Beutegreifern in Sicherheit zu bringen.
Bei Störungen durch den Menschen, oder bei widrigen Witterungsverhältnissen.
Flugschwache Insekten können im Windschatten von Hecken ihren Tätigkeiten nachgehen, ohne verfrachtet zu werden. Im kühl-schattigen Kernbereich von Hecken ist die Feuchtigkeit so hoch, dass sogar Amphibien und Arten des Feuchtgrün-landes vorkommen.
Der sonnenseitige Heckenrad weist generell artenreichere Pflanzengesellschaften und eine höhere Tierartendichte auf. An Heckenverzweigungen und dort wo Hecken auf andere Strukturen treffen, sind die meisten Tierarten anzutreffen.
Auch Hecken mit überschirmenden, älteren Einzelbäumen und verschieden alten Gehölzen sind artenreicher als solche ohne Einzelbäume. Aufgrund vieler verschiedener Pflanzenarten, bieten Hecken über einen langen Zeitraum des Jahres Blütenbesuchern Nahrung. Einige Weidenarten blühen bereits im März/ April. Im April/ Mai blühen Schlehen um im Juni/Juli folgen Rose, Eberesche, Holunder und im August Brombeerarten.
Ebenso von großer Bedeutung sind Hecken für die Avifauna, da die Mehrzahl der Vögel in Gehölzen brütet und dort Nahrung sucht. Die Struktur der Hecken beeinflusst die Artenzahl und Bestandsdichte. Doppelhecken, wie z.B. zu beiden Seiten eines Weges, weisen mehr Vogelarten auf als schmale Einzelhecken.
Lineare und kleinflächige Wiesenbiotope
(Pfosten 12)
Unter dem Begriff Wiesenbiotope werden hier folgende Landschafts-elemente zusammengefasst: Hochstauden, Säume, Feldrain, Wegrain, Stufenrain, Grasrain, Grassaum und Randstreifen, bzw. herbizidfreier Ackerrandstreifen. Es konnte in der Literatur keine Unterscheidung der Begriffe Saum und Rain gefunden werden, weshalb diese hier synonym verwendet werden. Alle genannten Biotope sind weitestgehend gehölzfrei und weisen Gras-, Stauden- oder Krautgesellschaften auf. Sie sind wichtig für das Überleben von vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten sowie für die Artenvielfalt allgemein. Der Grünlandanteil der Landschaft ging aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zurück. Meist wurden Wiesen nur dort erhalten, wo eine ackerbauliche Nutzung nicht möglich war. Z.B. auf Flächen mit einer Hangneigung von elf Prozent oder mehr, besonders trockene oder feuchte Standorte, sowie Flächen in Berglage. Ebenso wurde die ehemals vielfältige Grünlandnutzung durch Drainage und Düngung vereinheitlicht und Standortunterschiede nivelliert. Viele Arten sind durch Nutzungsaufgabe bedroht, denn diese anthropogen geschaffenen Ökosysteme wurden durch die Nutzung (Mahd, Beweidung etc.) im Gleichgewicht gehalten. Für das Vorkommen von Tierarten sind Strukturen der Vegetation entscheidend. Die Höhe der Pflanzen, ob Blätter horizontal oder vertikal ausgerichtet sind und ob Pflanzen Büschel bilden oder gleichmäßig verteilt sind. Diese Eigenschaften bestimmen auch das Kleinklima. Als Schichten sind die Bodenoberfläche, Streuschicht, Krautschicht sowie Blütenschicht zu nennen.
Unter einem Feldrain versteht man einen schmalen Streifen zwischen zwei Ackerparzellen, welcher unbebaut bleibt. Sie werden jedoch extensiv gemäht, manchmal auch überpflügt, weshalb sie keine dauerhaften Landschaftselemente darstellen. Oft sind sie durch die angrenzende Nutzung stark eutrophiert und artenarm. Meist sind sie 1-2 Meter breit. Es überwiegen Gras- und Krautfluren. Feld- und Staudenraine gehören zu den Lebensräumen, welche seid 1955 am stärksten abgenommen haben. Sie können sehr vielseitige Lebensgemeinschaften aufweisen und bieten in ihrer Gesamtheit über 1000 Gefäßpflanzenarten einen Lebensraum.
Kleingewässer und Pfützen
Kleingewässer bieten einer Vielzahl weiterer Tierarten Lebensraum. In trockenen Regionen entwickeln sich selbst in den Pfützen tiefer Fahrspuren Kaulquappen verschiedener Lurcharten. Den Schlamm der Pfützen nutzen Schwalben zum Nestbau.
Kleinklima
Entscheidend für die klimatischen Auswirkungen des Landschafts-elementes ist dessen Exposition, welche die Belichtungs-, Wind und Feuchteverhältnisse beeinflusst. Bäume und Sträucher fangen einen Großteil des Niederschlages auf, von denen dieser dann verdunstet. Eine in Ost-West-Richtung verlaufende Hecke wirft mehr Schatten als eine in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete. Dabei ist die Breite der Schattenzone im Frühjahr 1,3 mal so groß wie die Höhe des Landschaftselementes und im Sommer bei dann nur noch 0,5 mal so groß. Die Windstärke hängt unter anderem von der Rauigkeit des Geländes ab und wird daher von Landschaftselementen wie Hecken beeinflusst. Diese können Luft stauen und den Wind abbremsen, umlenken oder verwirbeln. Im Windschatten eines Landschaftselementes kommt es zu einer höheren Niederschlagsmenge und zu einer deutlich verringerten Verdunstung. Im Windschatten dauert es auch meistens länger bis Schnee abtaut und dieser verhindert ein tiefes Durchfrieren des Bodens. Außerdem werden im Windschatten vom Wind verfrachtete Tiere, wie kleine Spinnen und Blattläuse, abgesetzt. Aber auch der Kohlendioxidhaushalt wird vom Vorhandensein oder Fehlen von Wind beeinflusst. Im Windschatten wird atmosphärisches CO2 nicht so schnell nachgeliefert und das CO2, welches sich nachts durch die Bodenatmung in der bodennahen Luftschicht sammelt, wird nicht so schnell abtransportiert. Aber nicht nur Hecken, sondern auch alle anderen Landschaftselemente beeinflussen das Kleinklima. Auf Brachland z.B. bildet sich mehr Kaltluft als auf Acker. In immergrünen Nadelwäldern ist es im Winter wärmer und im Sommer kühler, als im Offenland. Wiesen bremsen die Windgeschwindigkeit und in ihnen herrscht eine höhere Luftfeuchtigkeit. Es treten meist große Temperaturschwankungen auf. Natürlich hängen die standortklimatischen Auswirkungen auch vom Großklima ab, jedoch erhöhen Saum- und Punktbiotope die kleinklimatische Vielfalt und wirken sich positiv auf die Artenvielfalt aus.
Historie Eichmühle (Pfosten 13)
Kurz hinter den Damm, vom Weiher aus gesehen, stand vor dem 30- Jährigen Krieg die Eichmühle. Diese wurde durch die Spanier zerstört. Ob überhaupt nach dem Krieg im Jahr 1648 in der Gemarkung Steinbach noch Menschen lebten ist fraglich. Historiker gehen davon aus, dass in der ganzen Pfalz nur noch ca. 200 Familien lebten. Allen anderen waren im Zeichen des Glaubens bzw. Kirche gestorben oder verhungert. Der Krieg brachte gleich zu Anfang großes Leid über die Pfalz. Schon im Herbst 1620 drangen die Spanier unter Spinola in die Pfalz ein. Sie wollten die ‘‘calvinistischen Ketzer verjagen und ausrotten und an derselben Statt katholischen Priester einsetzen, welche das gemeine Volk zur katholischen Religion unterrichten und anweisen sollen.’’ Sie besetzten fast die ganze Nordpfalz auf der Linie Bacharach-Kirn-Alzey Oppenheim. Rockenhausen und Kirchheim fielen bereits im November 1620 in die Hände der Spanier. Die Drangsale durch die Besatzung dauerten etwa 10 Jahre, in denen die Bewohner der Dörfer und Städte in Not und Elend gerieten.
Inzwischen marschierte König Gustav Adolf von Schweden ins Reich ein, um gegen die katholischen Kaiserlichen und Spanier zu kämpfen. Die Spanier zogen sich aus der Pfalz zurück, gefolgt von den nachrückenden Schweden.
Auch hier am Donnersberg fanden Kämpfe statt. Der Rückzug der Spanier spielte sich auf der Straße Standenbühl über den Eichhübel in Richtung Winnweiler ab. Die Spanier wurden immer wieder in Kämpfe mit den ihnen folgenden Schweden verwickelt und mussten dabei fast ihr ganzes Gepäck zurücklassen. Die Gefechte am 24.Mai 1632 haben sich in der Gegend zwischen Hahnweilerhof und Theresienhof abgespielt, wobei auch Steinbach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es wird berichtet, daß damals die Steinbacher Eichmühle niedergebrannt wurde. So hoffnungsvoll das pfälzische Volk den Einmarsch der Schweden als Befreiung erwartet hatte, so enttäuscht wurde es teilweise. Man mußte nämlich einsehen, daß man nur einen Austausch erlebte. Eine Besatzungsmacht löste die andere ab, und diese Neue zeigte sich ebenfalls bald als Herr. Einige pfälzische Lokalhistoriker, die den Spaniern keinesfalls gewogen waren, mußten zugestehen, dass die Vorfälle während der schwedischen Besatzungszeit das Verhalten der Spanier an Brutalität übertrafen.
In allen Städten wurde mit der Wiedereinführung der evangelischen Religion begonnen. Jedoch wollten die Schweden damit die lutherische Religion statt der vorherrschenden calvinistischen einführen, was wiederum zu Streitigkeiten führte.
Der Einfall der Schweden ins Reich war der Auftakt zu einem neuen Kriegsabschnitt. Während der folgenden Jahre wurde die Pfalz Schauplatz furchtbarer Szenen und zum Spielball der auswärtigen Mächte. Schweden, Deutsche Kroaten, Franzosen und auch wieder Spanier durchzogen das Land und verweilten dem Wechsel ihres Kriegsglücks entsprechend. Auch die in den folgenden Jahren wütende Pest trug dazu bei, dass die Pfalz am Ende des 17. Jahrhunderts ein ausgebranntes, zerstörtes und fast menschenleeres Land war.
Die Winterlinde
Auf der gegenüberliegenden Seite steht eine Winterlinde. In nahezu ganz Europa (außer dem hohen Norden) ist die Winterlinde sowie die Sommerlinde heimisch. Eine ebenso weitverbreitete Art ist die holländische Linde, eine Kreuzung der beiden. Sie ist eine der beliebtesten gepflanzten Stadt- und Straßenbäume.
Das Vorkommen der Winterlinde ist vor allem im Berg- und Hügelland und im Auenbereich größerer Flüsse. Die Winterlinde ist eine Schattenbaumart, d.h. sie erträgt bis ins Alter Beschattung – ein großer Vorteil im Wald und Park, da sie auch unter Altbäumen aufwachsen und gepflanzt werden kann.
Sie ist eine anspruchslose Baumart, die kaum Krankheit sowie Schäden aufweist und sogar bis 1.000 Jahre alt werden kann. Wird die Winterlinde abgesägt, treibt sie sofort wieder intensiv aus dem Stamm aus. Dieser ausgeprägte Überlebenswille trägt sicher auch zu ihrem hohen Lebensalter bei.
Linden sind die besten Alleenbäume: Sie wachsen turmförmig und entwickeln keine ausladende Krone, sie bilden die zarteste Belaubung und im Hochsommer erfüllen sie die Luft auf das angenehmste mit dem Duft ihrer Blüten.
Blüten und Früchte
Die Blüten öffnen sich zu Massen an jedem Baum erst im Juli, 2 Wochen später als bei der Sommerlinde. Der unverwechselbare Honigduft der Blüten lockt viele Bienen und Hummeln an. Nach der Bestäubung entwickeln sich die Früchte, kleine gestielte Nüsschen. Das zum Blütenstand gehörige, längliche Tragblatt fördert die Windverbreitung, bis zu 150 m weit. Die Früchte bleiben lange am Baum hängen und dienen Vögeln und Kleinsäugern als Nahrung.
Holznutzung:
Lindenholz ist das beliebteste Schnitzholz, da es sehr weich ist und nicht splittert. Viele Krippenfiguren bestehen daher aus Lindenholz, ebenso die meisten Altar- und Wandfiguren in Kirchen. Der Rindenbast wurde früher für Schnürsenkel, Kleidung, Taschen sowie Schuhe verwendet. Bis heute als Gärtnerbast – wegen seiner Reißfestigkeit.
In der Naturheilkunde ist besonders der Tee aus Lindenblüten hervorzuheben. Er ist schweiß- und wassertreibend, krampflösend, magenstärkend und blutreinigend.
Im Brauchtum spielt die Linde eine wichtige Rolle als Dorflinde, Gerichtslinde, Kirchlinde oder als Hofbaum.
Die Winterlinde ist auch in Zukunft in Zeiten des Klimawandels sehr gut als Baumart verwendbar und verdient unsere Wertschätzung.
Jagd und Natur (Pfosten 14)
Die Jagd in Deutschland ist auch eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, nämlich die von Wildtieren. Der Wald erfüllt in unserem dicht besiedelten Land vielfältige wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Funktionen. Allerdings gibt es in Mitteleuropa kaum noch natürliche Feinde für die sog. Schalenwild-Arten wie Reh-, Rot- und Gamswild. An die Stelle von Bär, Wolf und Luchs muss dann der Jäger treten. Denn wo Schalenwildbestände zu hoch sind, entstehen durch die Verwundung von Bäumen nicht nur waldbaulich, sondern auch wirtschaftlich relevante Verbiss-, Fege- und Schälschäden. Wenn zum Beispiel permanent die Triebe aller jungen Tannen aufgefressen werden, kann die natürliche Verjüngung des Waldes behindert und die Entwicklung von Mischwäldern gehemmt werden. Noch dazu tritt durch die Rindenverletzung beim Schälen durch Rotwild eine massive Holzentwertung an Bäumen und ganzen Waldbeständen auf. Wildverbiss und Rindenschälen werden von vielen Faktoren beeinflusst.
Diese sind Störungen in den Wildeinständen, Besatzdichte des Wildes und sich ändernde Biotopverhältnisse. Um stabile, vielfältig strukturierte Wälder zu erzielen, muss die Bejagung des Schalenwildes mit den waldbaulichen Erfordernissen im Einklang stehen.
Alle Bundesländer haben forstliche Gutachten als wichtigstes Kriterium für die Abschussplanung eingeführt. Deshalb ergibt sich insgesamt ein recht guter Überblick über die derzeitige Schadenssituation im Wald. Danach zeigt sich, dass Wildschäden lokal und regional eine erhebliche Rolle spielen. Dies gilt insbesondere für Gebiete mit unterdurchschnittlicher Waldausstattung oder hohem Erholungsdruck. Insgesamt ergibt sich jedoch aus den Berichten der Länder eine zumeist rückläufige Tendenz. Laut BWI 3 lag der Anteil der Pflanzen (20-130 cm Höhe) im Jahr 2012 ohne Verbiss deutschlandweit über alle Eigentumsarten hinweg bei 72,4%.
Wir brauchen Bäume – sie speichern Kohlendioxid!
Lebensraum Wasser – Feuchtbiotop
(Pfosten 15)
Die rheinland-pfälzischen Fließgewässer sind geprägt durch die Mittelgebirgslandschaften in Eifel, Westerwald, Hunsrück und Pfälzerwald. Dementsprechend sind die meisten Bäche und Flüsse in Rheinland-Pfalz durch hohes Gefälle, steinig-kiesige Bachbetten und turbulente Strömung gekennzeichnet. Diese Gewässer sind Lebensraum für eine vielfältige, artenreiche Gewässerflora und -fauna. Unter den wirbellosen Kleintieren und Fischen leben hier viele Arten, die an die hohen Strömungsgeschwindigkeiten der Gewässer angepasst sind und einen hohen Sauerstoffbedarf haben.
Der Unterschied zwischen Bächen und Flüssen.
Der Übergang von Bächen zu Flüssen ist fließend. Es gibt keine klare Abgrenzung, ab wann man von einem Fluss spricht oder bis wann von einem Bach. Manchmal wird gesagt, dass ein Gewässer ab einer Breite von 5 Metern Fluss genannt werden sollte. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass sie Wasser transportieren. Manchmal können Fließgewässer an einigen Stellen zu künstlichen Seen aufgestaut sein, aber auch hier gibt es einen Wasserdurchfluss.
Pflanzen und Tiere am Weiher
Naturnahe Kleingewässer zählen bei uns zu den artenreichsten Lebensräume. Im Wasser heranwachsende Larven von Amphibien und Libellen sind ebenso typische Bewohner von stehenden Kleingewässern, wie Schnecken und Frösche. Auch Schönheiten wie Seerosen, Rohkolben oder der seltene Sumpfdrachenwurz finden optimale Bedingungen. In den Uferbereichen von Gewässern fühlen sich Frosch & Co. sowie Kleinamphibien wohl. Typische Tiere an Seen und Weiher ist die Ringelnatter und Wasservögel wie Stockenten, Kormorane, Stelzvögel, Teich –und Sumpfrohrsänger sowie der Graureiher.
Ein seltener Gast ist der Eisvogel.
Unter der Wasseroberfläche tummelt sich in vielen Gewässern eine Vielfalt an Fischarten. So sind neben Forellen, Karpfen, Zander sowie der Hecht, auch Krebse die bekanntesten Bewohner der Wassertiefen.
Kostbares Nass – unser blauer Planet
Zu über 70 Prozent ist die Erdoberfläche mit Wasser bedeckt. Würde man das ganze Nass in einen großen Würfel schütten, würde dieser 1,4 Milliarden Kubikkilometer umfassen – was einer Kantenlänge von etwa 1118 Kilometern entspricht. Dies entspricht in etwa der Luftlinie zwischen Lübeck und Florenz. Süßwasser macht dabei nur einen kleinen Teil des gesamten Wasservolumens aus – genau genommen nur 2,5 Prozent. Davon ist das meiste in Form von Eis oder Schnee in der Arktis oder der Antarktis gebunden. Der Rest ist als Grundwasser unter der Erde gespeichert. Neben Binnenseen und Flüssen stellt es die wichtigste Süßwasserquelle für die Menschen dar.
Jeden Tag gelangen zwei Millionen Tonnen Abwasser und andere menschliche Abfälle in den Wasserkreislauf. Laut UN sterben jedes Jahr 3,5 Millionen Menschen wegen Wassermangel oder verschmutztem Trinkwasser. Die Lebensadern unseres Planeten sind bedroht – und mit ihnen die Ökosysteme, die an ihnen hängen. Helfen Sie mit:
Schützt unser Wasser, unsere Seen und Flüsse!
Waldklima 1 (Pfosten 16)
Lufttemperatur und Wind
Im Wald ist die Lufttemperatur im Sommer kühler als auf einer Wiese. Das ist darauf zurückzuführen, dass nur ein kleiner Teil der Sonnenstrahlen durch die Blätter auf den Boden gelangt. Der Waldboden liegt die meiste Zeit des Tages im Schatten. Die Windgeschwindigkeit und die Sonneneinstrahlung im Wald sind verringert. Das kommt daher, weil der Wind an jedem Baum und Strauch ein wenig abgebremst wird. Selbst an windigen Tagen kann es also vorkommen, dass es in einem dichten Wald in Bodennähe nahezu windstill ist.
Niederschlag
Der Regen fällt auf das Kronendach der Bäume und die Regentropfen sammeln sich auf den Blättern. Wenn der Regen sehr stark ist, fließen die Tropfen über die Äste den Stamm hinunter. Nur ein kleiner Teil tropft von den Blättern direkt auf den Boden. Bei Regen wird man im dichten Wald also weniger nass als im Umland. Wenn im Winter Schnee liegt, bleibt dieser auf dem Waldboden länger liegen als auf dem Feld oder in der Stadt. Besonders gut zu beobachten ist das in Nadelwäldern, da diese im Frühling viel Schatten spenden.
Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit ist im Wald deutlich erhöht. Das kommt daher, dass die Bäume über ihre Blätter ständig Wasser verdunsten. Eine ausgewachsene Buche kann auf diese Weise so viel Wasser an die Umgebung abgeben, dass 6 Badewannen gefüllt werden könnten. Wenn der Waldboden mit Pflanzen bewachsen ist, wird die Luftfeuchtigkeit zusätzlich erhöht, da diese ebenso wie die Bäume über die Blätter Feuchtigkeit abgeben. Früh morgens, wenn es dunstig ist, kann man diese Feuchte sehen.
Waldklima 2 (Pfosten 17)
Aufatmen
Wer kennt sie nicht, die sprichwörtlich „gute Luft“ im Wald? Tatsächlich ist die Waldluft etwas Besonderes. Im Wald ist es kühl, die Luft ist feuchter, die Bäume schützen vor Wind und das Kronendach vor Sonnenstrahlung. Sie alle zusammen machen das typische Waldinnenklima aus und die Waldluft so gesund. Der Wald ist wie eine natürliche Klimaanlage. Auch die Umgebung des Waldes profitiert davon. Der Wald wirkt ausgleichend auf das Klima, er bremst den Wind, er sammelt und speichert Wasser. Außerdem bietet der Wald auch akustisch ein einzigartiges Erlebnis. Bei leichtem Wind ist das Rauschen der Blätter im Wald mit 20 Dezibel sogar leiser als das Ticken eines Weckers. Medizinische Untersuchungen belegen, was Waldbesucher schon lange wissen. Der Aufenthalt im Wald wirkt beruhigend und entspannend. Er stärkt das Immunsystem und hilft, Stress und psychische Belastungen abzubauen.
Ätherische Öle und Duftstoffe
Neben Sauerstoff geben die Bäume aber auch ätherische Öle und Duftstoffe ab. Damit schützen sie sich vor Baumkrankheiten, Insektenbefall und anderen Schaderregern. Auf uns Menschen wirken diese Panzenstoffe ausgleichend und gesundheitsfördernd.
Sauerstoff
Bäume erzeugen den Stoff, den unsere Welt zum Leben braucht. Jeder Baum ist eine solarbetriebene Fabrik, die Sauerstoff, Holz und andere natürliche Stoffe herstellt. Ein 100-jähriger Eichenwald nimmt pro Jahr und Hektar circa elf Tonnen Kohlendioxid aus der Luft auf und erzeugt daraus rund drei Tonnen Panzenmasse (Blätter, Rinde, Wurzeln, Blüten, Früchte, Holz) und bis zu acht Tonnen Sauerstoff. Auch andere Panzen erzeugen Sauerstoff. Aber weil Bäume so groß sind und im Wald viele Bäume stehen, ist die Luft im Wald besonders reich an Sauerstoff. Insgesamt erzeugt der Wald in Deutschland etwa 25 bis 38 Millionen Tonnen Sauerstoff pro Jahr. Das ist das ein- bis eineinhalbfache dessen, was alle Einwohner Deutschlands in einem Jahr zum Atmen brauchen. Rund 300 Kilogramm Sauerstoff braucht ein Mensch pro Jahr zum Atmen.
Staubfreiheit
Die Blätter und Nadeln der Bäume filtern Staub und Schadstoffe aus der Luft. Ein einziger Hektar Wald filtert pro Jahr bis zu 60 Tonnen Staub, daher ist die Luft im Wald besonders Staubarm. Sie enthält bis zu 100-mal weniger Staub als die Luft in Großstädten.
Wald – Was bedeutet Nachhaltigkeit?
(Pfosten 18)
Der Begriff Nachhaltigkeit beschreibt ein Nutzungskonzept. Kern ist es, eine Ressource so zu nutzen, dass sie keinen bleibenden Schaden nimmt und auch künftigen Generationen in gleicher Weise zur Verfügung steht. Nachhaltigkeit bedeutet Maßhalten, Selbstdisziplin und Selbstbeschränkung. Nachhaltigkeit ist das Gegenkonzept zur rücksichtslosen Ausbeutung einer Ressource. Genetische Vielfalt erhalten Die genetische Vielfalt der Waldbäume ist von grundlegender Bedeutung für die Waldökosysteme. Sie ist Voraussetzung für die Fähigkeit der Waldbäume, sich an unterschiedliche Umweltbedingungen anzupassen. Der Genpool bestimmt aber auch weitere Baumeigenschaften, die für die Forstwirtschaft wichtig sind, z. B. das Wuchsverhalten, die Wuchsform oder bestimmte Holzeigenschaften. Die Vielfalt der forstgenetischen Ressourcen ist daher für die Anpassungs-und Leistungsfähigkeit der Waldbäume wesentlich. Die Forstverwaltungen des Bundes und der Länder verfolgen seit 1987 ein gemeinsames Konzept zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung forstlicher Genressourcen. Naturnahe Waldbewirtschaftung ist hierbei ein wesentliches Element, denn sie setzt auf eine natürliche Verjüngung und fördert seltene Mischbaumarten. Hinzu kommt ein Bündel von weiteren Maßnahmen, die speziell auf die Erhaltung der genetischen Vielfalt ausgerichtet sind.
Hierzu zählen unter anderem:
- die Ausweisung von Saatguterntebeständen,
- die Anlage von besonderen Samenplantagen,
- die Anlage und Unterhaltung von Genbanken,
- genetisches Monitoring zur Analyse der genetischen Vielfalt der Waldbäume,
- die Züchtung von anpassungsfähigem und leistungsstarkem
- Vermehrungsgut, forstgenetische Forschung sowie
- die nationale und internationale Kooperation bei Forschung und
- Generhaltung
Wir sind auf dem Weg zur Klimakatastrophe
Der Klimawandel und die damit verbundene Häufung und Verschärfung von Witterungsextremen, wie Hitze und Trockenheit sowie von extremen Stürmen, stellt eine große Herausforderung für den Wald und die Forstwirtschaft dar. Besonders problematisch für den Wald ist, dass sich die Klimaveränderungen vergleichsweise rasch vollziehen, so dass die Bäume sich nicht entsprechend schnell anpassen können. Die Waldbestände sind in ihrer Lebensspanne daher wechselnden Umwelt- und Wachstumsbedingungen ausgesetzt. Wenn die Umweltveränderungen das Anpassungsvermögen der Waldbestände überschreiten, leidet das gesamte Waldökosystem darunter. Die Waldbesitzer müssen in ihrer Planung zukünftige Veränderungen der Wuchsbedingungen berücksichtigen, ohne zu wissen, wo und in welchem Umfang sich welche Veränderungen vollziehen werden. Die wichtigste Maßnahme gegen den Klimawandel ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Dies betrifft vor allem die Freisetzung von Kohlendioxid (CO2) aus dem Verbrauch fossiler Energieträger, aber auch aus der nicht-nachhaltigem Nutzung und Rodung von Wäldern, wie sie in anderen Teilen der Welt vorkommen. Gleichzeitig ist es erforderlich, unsere Wälder auf den Klimawandel vorzubereiten. Ziel sind standortgerechte und strukturreiche Mischwälder. Sie werden den gegenwärtigen Anforderungen und künftigen Herausforderungen am besten gerecht. Zugleich wird so die nachhaltige Versorgung mit dem umweltfreundlichen, nachwachsenden Rohstoff und Energieträger Holz sichergestellt.